Historisch - wissenschaftlich - pädagogischer Hintergrund
Musikpädagogen haben über Jahrhunderte durch Praxis und Beobachtung effektive Methoden entwickelt. Intuitiv erkannten sie, was beim Lernen funktioniert. Neurowissenschaft und kognitive Forschung liefern heute wissenschaftliche Erklärungen dafür – etwa für Solmisation und Rhythmussilben-Systeme.
Zoltán Kodaly (1882-1967) war nicht nur ein herausragender Komponist, sondern auch ein visionärer Pädagoge. Seine Konzeption und die von seinen Mitarbeitern ausgesarbeitete Methode verbindet kulturelle Identität mit systematischem Lernen und hat die musikalische Bildung nachhaltig geprägt – sowohl in Ungarn als auch weltweit. Ziel ist der Systematische Aufbau von Hör-, Lese- und Schreibfähigkeiten. Man könnte den Weg unter das Motto stellen vom Singen zur Schrift, von der Schrift zur Kunst
- Stimme ist das primäre Instrument, und musikalische Bildung beginnt mit dem Singen.
- die relative Solmisation hilft, Tonhöhen zu verinnerlichen.
- Rhythmussilben fördern die rhythmische Kompetenz.
- Zur Visualisierung von Tonstufen können Handzeichen verwendet werden.
Ausführliches Material dazu finden Sie im Internet unter dem Suchbegriff "Kodaly" und auf der Webseite der deutschen Kodaly-Gesellschaft www.kodaly.de
Edwin Gordon (1927-2015) hat sich merhfach in dem Sinne geäußert, dass seine Arbeiten im Verhältnis zu anderen musikpädagogischen Ansätzen wie Kodály, Orff oder Dalcroze als evolutionär und nicht revolutionär zu verstehen sind.
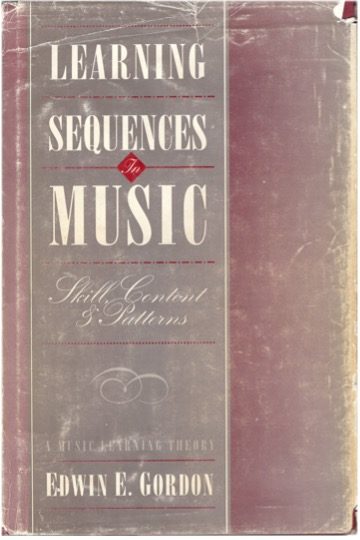
Die 1980 von Edwin Gordon (1927-2015) vorgestellten „Learning Sequences In Music“ waren bahnbrechend. Die Grundgedanken waren nicht neu, aber erstmals wurde konsequent durchdacht, was es bedeutet, daß Singen die früheste Form des Musizierens ist und daß deshalb die Musikpädagogik beim kindlichen Singen ansetzen und darauf aufbauen muß.
Man könnte Gordons Konzeption unter das Motto Sound before Sight, Sign and Symbol stellen
Das alles löste eine Flut musikpädagogischer Beiträge aus.
Eine kompakte Einführung in Gordons „Music Learning Theory“ finden Sie hier:
https://www.gordon-gesellschaft.de/edwin-gordons-music-learning-theory-eine-einfuehrung/
Edwin Gordon und die Musikalische Früherziehung
Gordon machte eine ganze Reihe empirischer Untersuchungen, auf deren Basis er seine Musiklerntheorie formulierte. Er selber hat daraus Konzepte für die Anwendungen in der musikpädagogische Praxis entwickelt und seine Impulse sind in vielen Lehrwerken deutlich erkennbar. Dabei spielen Patterns und Pattern Learning eine zentrale Rolle. Gordon differenziert den Begriff Pattern in einem ausführlichen Glossary und spricht von „Rhythm Pattern“, „Tonal Patterns“, „Cadencial Patterns“, „Chromatic Patters“ und vielen weiteren mit einem Adjektiv versehenen Patterns.
Gordons Ausführungen klingen unmittelbar einleuchtend, aber folgende Fragen scheinen mir (noch) nicht beantwortet zu sein: Was genau sind Patterns und welche Rolle spielen sie? Sind Patterns so etwas wie ein musikalischer Grundwortschatz?
Gordon stellt häufig Vergleiche mit dem Erwerb der Muttersprache an. Die Muttersprache erwerben die Kinder „en passant“, ohne pädagogische Maßnahmen. Wortschatz, Grammatik, Sprachmelodie und weiterer Charakteristika der Muttersprache, für Kleinkinder ist das ist alles eins. Und das betrifft auch die Kinderlieder. So wie Hüpfen, Rennen und Schleichen besondere Formen des Gehens sind, so ist Singen eine besondere Form des Sprechens, Singen ist Sprechen auf bestimmten Tonhöhen. Wo ist genau der Bedarf für eine Musikpädagogik? Was „passiert“ nicht von selbst?
Gordon vergleicht Musiklernen mit dem Erwerb der Muttersprache und betont, daß Kinder sprechen und singen können, lange bevor schriftliche Zeichen in irgendeiner Form ins Spiel kommen. Im Kern der Überlegungen steht dabei der Begriff „Verstehen“. Sprache verstehen heißt, den Sinn und die Bedeutung auditiver Äußerungen erfassen. Aber was bedeutet „Musik verstehen“? Dafür prägte Gordon den Begriff Audiation, abgeleitet von lateinisch „audire“ (hören). Gordons Überlegungen wurde auch deshalb besonders attraktiv, weil plausibel erscheinende Querverbindungen zur gleichzeitig sich stürmisch entwickelnden Gehirn- und Kognitionsforschung hergestellt werden konnten.
Lohnt sich aus Sicht der Praxis ein Methodenstreit?
Methodenstreitigkeiten zwischen Kodály- und Gordon-Anhängern haben die Musikpädagogik nicht vorangebracht. Gordon selber hat sich mehrfach in dem Sinne geäußert, dass seine Arbeiten im Verhältnis zu anderen musikpädagogischen Ansätzen wie Kodály, Orff oder Dalcroze als evolutionär und nicht revolutionär zu verstehen sind.
guiDo! und tabDo! können Sie ohne weiteres mit den Konzepten und Methoden Kodalys und Gordons verbinden.
Mit einer Einschränkung: das sind die Rhythmus-Silben.
Kodálys absolute Rhythmussilben (ta = Viertelnote) kollidieren mit Gordons relativer Betonungslogik (du = Schwerpunkt). Aber auch da gibt es inwzischen Modelle, die die Kodaly-Silben im Sinne der Betonunglogik umsortieren. Mehr dazu unter "rapDo".
rapDo! bietet zur Zeit nur die Rhythmussilben von Gordon. Eine Version mit Kodaly-Silben ist in Arbeit und wird mit einem update veröffentlich werden.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.